Lesedauer: 19 Minuten
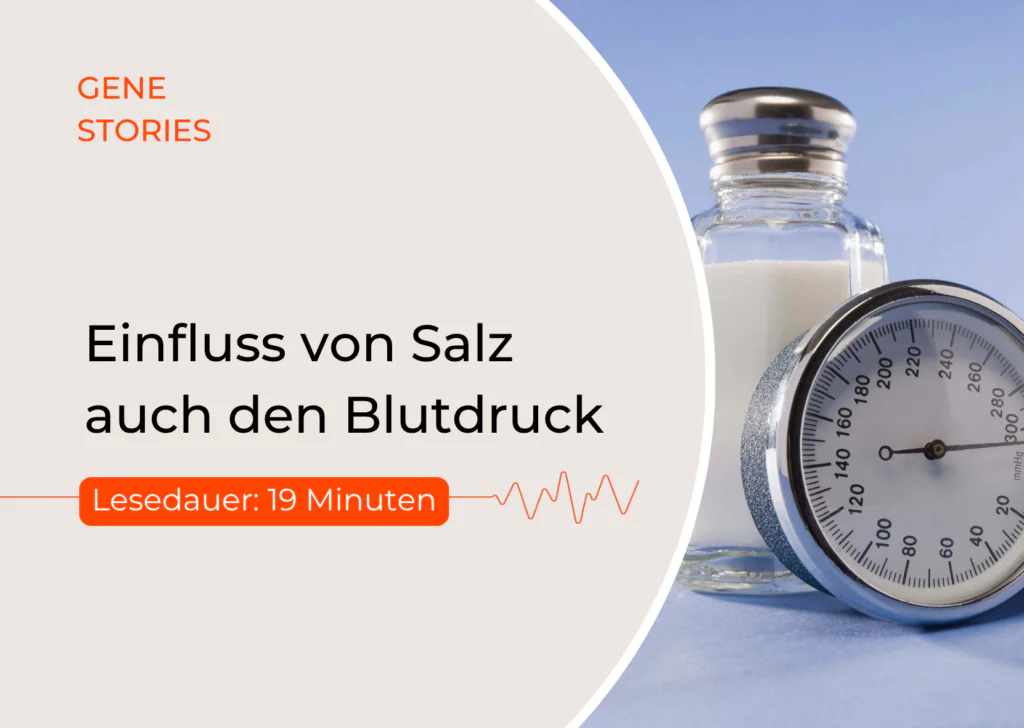
Lesedauer: 19 Minuten

Natriumchlorid ist für zentrale physiologische Prozesse unverzichtbar – insbesondere für den Flüssigkeits- und Elektrolythaushalt sowie die neuromuskuläre Erregungsleitung. Gleichzeitig stellt eine chronisch erhöhte Salzzufuhr eine der wichtigsten modifizierbaren Risikokonstellationen für die Entstehung arterieller Hypertonie dar. Die blutdrucksteigernde Wirkung von Salz beruht nicht nur auf Volumenzunahme und hormonellen Anpassungen im Renin-Angiotensin-Aldosteron-System (RAAS), sondern auch auf direkten Effekten auf das Gefäßendothel und immunologische Signalwege. Im Mittelpunkt steht dabei das AGT-Gen, das für Angiotensinogen kodiert – ein Schlüsselmolekül des RAAS. Genetische Varianten in diesem Gen können die Empfindlichkeit gegenüber Salzkonsum erheblich beeinflussen und die individuelle Neigung zu Bluthochdruck verstärken. Der folgende Beitrag beleuchtet die physiologischen Mechanismen, die Rolle genetischer Polymorphismen im AGT-Gen und gibt praxisrelevante Hinweise zur personalisierten Prävention und Therapie bei salzsensitivem Blutdruckverhalten.
Ein chronisch hoher Salzkonsum kann über osmotisch bedingte Volumenveränderungen, hormonelle Reaktionen (RAAS) und vaskuläre Entzündungsprozesse zu arterieller Hypertonie führen – insbesondere bei salzsensitiven Personen.
Ein zentrales Gen in der Blutdruckregulation ist das AGT-Gen, das für Angiotensinogen codiert. Die Genvariante rs699 (A/A) erhöht die Angiotensinogenproduktion und führt zu einer Überaktivierung des Renin-Angiotensin-Aldosteron-Systems – mit langfristiger Folge einer chronischen Blutdrucksteigerung.
Diese genetische Prädisposition wird durch Lebensstilfaktoren wie hoher Salzkonsum, Übergewicht oder Stress verstärkt. Betroffene reagieren empfindlicher auf Natriumüberschuss, zeigen häufiger Entzündungszeichen im Gefäßsystem und haben ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
Für die medizinische Praxis ist wichtig, dass bei Patient:innen mit AGT-rs699-Risikovarianten (v. a. A/A) eine salzarme Ernährung, kaliumreiche Kost und eine gezielte Versorgung mit gefäßschützenden Mikronährstoffen (Magnesium, Vitamin D, Omega-3) empfohlen wird.
Salz, chemisch als Natriumchlorid (NaCl) bezeichnet, zählt zu den ältesten und gleichzeitig lebensnotwendigsten Substanzen, die der Mensch regelmäßig mit der Nahrung aufnimmt. In seiner elementaren Zusammensetzung besteht Salz zu etwa 40 % aus Natrium und zu 60 % aus Chlorid. Beide Ionen erfüllen essenzielle Funktionen im menschlichen Organismus und sind an einer Vielzahl physiologischer Prozesse beteiligt, die sowohl intrazellulär als auch extrazellulär eine zentrale Bedeutung haben. Die Aufnahme von Salz über die Nahrung ist für die Aufrechterhaltung des osmotischen Gleichgewichts, der neuromuskulären Erregungsleitung, der Säure-Basen-Balance sowie der zirkulatorischen Homöostase zwingend erforderlich. Natrium stellt das mengenmäßig wichtigste Kation des extrazellulären Raumes dar. Sein Konzentrationsgradient ermöglicht grundlegende Prozesse wie die Erregungsleitung in Nerven- und Muskelzellen, die Absorption von Nährstoffen im Darm, sowie die Filtrations- und Rückresorptionsmechanismen der Niere. Chlorid wiederum ist das häufigste extrazelluläre Anion und spielt eine entscheidende Rolle bei der Regulation des Zellvolumens, der osmotischen Druckverhältnisse und der Bildung der Magensäure (HCl) im Magenfundus. Im physiologischen Gleichgewicht wird die Natriumkonzentration im Blutplasma eng reguliert, typischerweise zwischen 135 und 145 mmol/l. Bereits geringfügige Abweichungen von diesem Normbereich können schwerwiegende funktionelle Konsequenzen nach sich ziehen. Die tägliche Zufuhr erfolgt nahezu ausschließlich über die Ernährung. Während der Körper bei Natriummangel über hormonelle Gegenregulationsmechanismen (RAAS, ADH, Sympathikusaktivität) versucht, Natrium effizient zu reabsorbieren und Wasser zu konservieren, stellt eine chronisch überhöhte Salzzufuhr eine erhebliche Belastung für das kardiorenale Regulationssystem dar, insbesondere mit Blick auf die Entwicklung arterieller Hypertonie.
Der Mechanismus, über den Salz zur Blutdrucksteigerung beiträgt, ist vielschichtig und umfasst sowohl volumenvermittelte als auch hormonelle und endotheliale Komponenten. Ein hoher Natriumgehalt im Extrazellulärraum führt über osmotische Effekte zur Wasserrückhaltung, mit der Konsequenz eines gesteigerten Blutvolumens (Hypervolämie) und in der Folge eines erhöhten intravaskulären Drucks. Dieser Effekt wird zusätzlich durch eine Aktivierung zentralnervöser Durstzentren im Hypothalamus unterstützt, was die Flüssigkeitszufuhr weiter erhöht. Die Niere steht im Zentrum der natriuretischen Homöostase. Sie reguliert durch gezielte Rückresorptionsprozesse in den proximalen und distalen Tubuli die Natriumausscheidung und damit das zirkulierende Volumen. Bei erhöhter Natriumzufuhr reagiert der juxtaglomeruläre Apparat mit einer reduzierten Reninfreisetzung, wodurch die Bildung von Angiotensin I und in der Folge Angiotensin II vermindert wird. Gleichzeitig sinkt die Aldosteronausschüttung aus der Zona glomerulosa der Nebennierenrinde. Diese hormonelle Kaskade bewirkt eine verminderte Rückresorption von Natrium in den Sammelrohren und fördert so die Natriurese. Das Renin-Angiotensin-Aldosteron-System (RAAS) fungiert somit als feingetakteter Regelkreis, der auf erhöhte Salzbelastung adaptiv reagiert.
Neben den volumen- und hormonvermittelten Effekten ist auch die direkte Wirkung von Natrium auf das Gefäßendothel relevant. Ein hoher Salzgehalt kann die endotheliale Freisetzung von Stickstoffmonoxid (NO) hemmen, was zu einer erhöhten Gefäßsteifheit und gesteigertem peripheren Widerstand führt. Zusätzlich fördern hohe Natriumkonzentrationen die Ausbildung eines proinflammatorischen vaskulären Mikromilieus. Es konnte gezeigt werden, dass Natrium die Differenzierung von Th17-Zellen stimuliert, welche über die Sekretion von Interleukin-17 (IL-17) entzündungsfördernd und blutdrucksteigernd wirken. Diese immunologischen Aspekte verdeutlichen, dass die Wirkung von Salz nicht ausschließlich hämodynamisch zu betrachten ist, sondern tief in die Interaktion zwischen Gefäßbiologie und Immunsystem eingreift.
Insgesamt ergibt sich ein hochkomplexes Bild, in dem Salz nicht nur als Nahrungsbestandteil, sondern als hormonell, immunologisch und genetisch wirksamer Regulator des Blutdrucks verstanden werden muss. Während ein Mindestmaß an Natrium essenziell für das Überleben ist, führt eine chronisch übermäßige Zufuhr, wie sie in der westlichen Ernährung üblich ist, bei einigen Personen zu einer Dysregulation mehrerer Systeme, deren gemeinsames Resultat eine persistierende arterielle Hypertonie darstellt.

Das AGT-Gen (Angiotensinogen) kodiert für das gleichnamige Glykoprotein Angiotensinogen, das eine zentrale Rolle im Renin-Angiotensin-Aldosteron-System (RAAS) spielt und somit maßgeblich an der Regulation von Blutdruck, Elektrolythaushalt und Flüssigkeitsvolumen beteiligt ist. Das Gen befindet sich auf Chromosom 1 am Locus q42.2 (langer Arm des Chromosoms) und umfasst etwa 13.000 Basenpaare. Die Genexpression erfolgt primär in der Leber, aber auch in Adipozyten, dem Zentralen Nervensystem, der Niere und dem Plazentagewebe. Die Transkription wird durch hormonelle und inflammatorische Signale (z. B. Glukokortikoide, Östrogene, IL-6) reguliert. Das resultierende Protein, Angiotensinogen, wird als inaktives Vorläufermolekül in die Blutbahn abgegeben und bildet das Ausgangssubstrat des Renin-Angiotensin-Aldosteron-Systems (RAAS), das zu den wichtigsten endokrinen Regelsystemen des menschlichen Körpers zählt. Das RAAS wird aktiviert, wenn die Niere eine Abnahme des renalen Perfusionsdrucks oder eine verringerte Natriumkonzentration registriert. In diesen Situationen setzen Zellen der Niere das Enzym Renin frei, eine Aspartatprotease, die Angiotensinogen an einer spezifischen Position spaltet. Dadurch entsteht das Dekapeptid Angiotensin I (Ang I), eine noch biologisch inaktive Vorstufe. Angiotensin I zirkuliert im Blut und gelangt vor allem in die Lungenkapillaren, wo es durch das membranständige, zinkabhängige Enzym Angiotensin-Converting Enzyme (ACE) in das aktive Angiotensin II (Ang II) umgewandelt wird. Dieser Schritt ist biochemisch entscheidend, da Ang II die primären physiologischen Effekte des RAAS vermittelt. Angiotensin II ist ein kurzes Oktapeptid mit hoher Affinität zum AT1-Rezeptor, einem G-Protein-gekoppelten Rezeptor, der auf glatten Gefäßmuskelzellen, in der Nebennierenrinde, im Hypothalamus sowie in der Niere exprimiert ist. Die Bindung von Ang II an AT1 aktiviert die Phospholipase C, wodurch Inositoltriphosphat (IP₃) und Diacylglycerol (DAG) freigesetzt werden. IP₃ führt zur Freisetzung von Kalzium aus dem endoplasmatischen Retikulum, was eine Kontraktion der glatten Muskulatur bewirkt, mit der Folge einer Vasokonstriktion und damit einem raschen Anstieg des systemischen Blutdrucks. Parallel stimuliert Ang II die Freisetzung von Aldosteron aus der Zona glomerulosa der Nebennierenrinde. Aldosteron wirkt auf die Sammelrohre der Niere, wo es die Expression epithelialer Natriumkanäle (ENaC) und der basolateralen Na⁺/K⁺-ATPase fördert. Dies führt zu einer vermehrten Natriumrückresorption und sekundär zur Wasserrückhaltung, wodurch das zirkulierende Volumen weiter ansteigt. Zusätzlich wird im Hypothalamus die Freisetzung von ADH (antidiuretisches Hormon) angeregt, was über eine Erhöhung der Aquaporin-2-Expression in den Sammelrohren die Wasserrückresorption weiter steigert. Ang II fördert zudem das Durstgefühl und wirkt langfristig proinflammatorisch, profibrotisch und prooxidativ, insbesondere über die Aktivierung von NADPH-Oxidasen, die Bildung reaktiver Sauerstoffspezies und die Induktion entzündlicher Signalwege (z. B. NF-κB, TGF-β, IL-6). Eine besondere Bedeutung kommt genetischen Varianten des AGT-Gens zu. Der am besten untersuchte Polymorphismus (rs699), bei dem an Position 235 die Aminosäure Methionin durch Threonin ersetzt ist. Die T-Variante führt zu einer erhöhten mRNA-Stabilität und einer gesteigerten Transkription, was zu höheren Plasmaspiegeln von Angiotensinogen führt. In der Folge steht mehr Substrat für Renin zur Verfügung, was die Bildung von Angiotensin II erhöht und zu einer chronischen Überaktivierung des RAAS beitragen kann. Diese Genvariante wurde in zahlreichen populationsbasierten Studien mit einem erhöhten Risiko für essentielle Hypertonie, Präeklampsie, Schlaganfälle und kardiovaskuläre Ereignisse in Verbindung gebracht. Eine dauerhaft gesteigerte Aktivität des RAAS, sei es durch genetische Disposition, einen hohen Salzkonsum, chronischen Stress oder renale Hypoperfusion, führt zu einem erhöhten Blutdruck, strukturellen Umbauprozessen in Herz und Gefäßen und langfristig zur Entstehung vaskulärer Endorganschäden. Die gezielte pharmakologische Hemmung dieser Kaskade (z. B. durch ACE-Hemmer, AT1-Rezeptorblocker oder Aldosteronantagonisten) ist daher eine zentrale therapeutische Strategie bei Bluthochdruck, Herzinsuffizienz und chronischer Nierenerkrankung.
Eine besonders relevante genetische Variante im Zusammenhang mit dem AGT-Gen (Angiotensinogen) ist der rs699-Polymorphismus, auch bekannt als M235T. Dabei handelt es sich um einen Einzelnukleotid-Polymorphismus (SNP), bei dem an Position 704 im Exon 2 des Gens ein Adenin (A) durch ein Guanin (G) ersetzt ist. Diese Substitution führt auf Proteinebene zu einem Aminosäureaustausch: Anstelle von Methionin (M) wird Threonin (T) an Position 235 in das Angiotensinogen-Protein eingebaut. Der rs699-Polymorphismus ist funktionell bedeutsam, da er direkt die Expression des AGT-Gens sowie die Konzentration von zirkulierendem Angiotensinogen beeinflusst.
Personen mit dem G/G-Genotyp weisen eine normale Transkriptionsrate des AGT-Gens und physiologische Plasmaspiegel von Angiotensinogen auf. Die Aktivität des Renin-Angiotensin-Aldosteron-Systems (RAAS) bleibt in diesem Fall im Rahmen der normalen homöostatischen Kontrolle. Es kommt lediglich zu einem geringfügigen Anstieg der Angiotensinogenproduktion unter stimulierenden Bedingungen. Beim A/G oder G/A-Genotyp ist die AGT-Expression bereits moderat erhöht. Die betroffenen Personen tragen eine Kopie des Risikoallels, was zu einer leicht gesteigerten Synthese von Angiotensinogen führt. In funktioneller Hinsicht bedeutet dies eine erhöhte Substratverfügbarkeit für das Enzym Renin, das Angiotensinogen in Angiotensin I umwandelt, der erste Schritt in der Aktivierung des RAAS. Dieser Effekt kann in Verbindung mit weiteren genetischen Varianten oder ungünstigen Lebensstilfaktoren (z. B. hoher Salzkonsum) zu einem messbaren Blutdruckanstieg führen. Besonders relevant ist jedoch die A/A-Konstellation, bei der beide Allele das Risikoallel tragen. Diese genetische Variante ist mit einer deutlich erhöhten Transkription des AGT-Gens verbunden. Studien zeigen, dass die Angiotensinogen-Plasmakonzentrationen in A/A-Trägern signifikant über denen von G/G-Trägern liegen, ein Effekt, der in Zellkulturmodellen und in vivo bestätigt wurde. Die Folge ist eine dauerhaft erhöhte Produktion von Angiotensin I, das durch das Angiotensin-Converting Enzyme (ACE) in das aktive Angiotensin II überführt wird. Ang II wiederum ist ein potenter Vasokonstriktor, fördert die Aldosteronfreisetzung, erhöht die Rückresorption von Natrium und Wasser in der Niere und stimuliert proinflammatorische Prozesse im Gefäßendothel. Die kumulative Wirkung führt zu einem starken Anstieg des Blutdrucks, insbesondere bei zusätzlicher RAAS-Aktivierung durch Umweltfaktoren wie Salz, Stress oder körperliche Inaktivität. Die A/A-Variante des rs699-Polymorphismus gilt daher als funktionell aktivierende Mutation, die die individuelle Neigung zu essentieller Hypertonie signifikant erhöht. In epidemiologischen Studien konnte gezeigt werden, dass A/A-Träger im Vergleich zu G/G-Trägern ein signifikant höheres Risiko für Bluthochdruck, Schwangerschaftshypertonie (Präeklampsie), Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Schlaganfälle aufweisen. Besonders kritisch ist die Konstellation, wenn zusätzlich Polymorphismen in anderen RAAS-relevanten Genen vorliegen, etwa dem ACE-I/D-Polymorphismus oder dem A1166C-Polymorphismus im AGTR1-Gen.
Aus präventivmedizinischer Sicht ist die Bestimmung des AGT-rs699-Genotyps daher von hoher Relevanz: Während G/G-Träger in der Regel nur ein geringes Risiko für eine RAAS-Überaktivierung aufweisen, sollten insbesondere A/A-Träger frühzeitig auf Lebensstilmaßnahmen wie salzarme Ernährung, Gewichtsregulation, Stressmanagement und gegebenenfalls gezielte pharmakologische Interventionen hingewiesen werden. Auch in der Therapieantwort auf RAAS-Blocker (z. B. ACE-Hemmer oder AT1-Blocker) könnten Genotypunterschiede künftig eine Rolle spielen.
Zusammenfassend lässt sich sagen: Der rs699-Polymorphismus im AGT-Gen beeinflusst maßgeblich die Expression des Angiotensinogen-Gens und damit die Aktivierbarkeit des Renin-Angiotensin-Systems. Je nach Genotyp resultieren daraus unterschiedliche individuelle Risiken für Bluthochdruck und Folgeerkrankungen. Die Genotypisierung dieses Polymorphismus stellt daher ein wertvolles Instrument im Rahmen personalisierter Prävention und Therapie dar, insbesondere bei Personen mit familiärer Vorbelastung oder erhöhtem kardiometabolischen Risiko
Ein hoher Salzkonsum ist in unserem Alltag weit verbreitet, oft, ohne dass wir es bewusst wahrnehmen. Denn Salz steckt nicht nur in der klassischen „Prise zum Nachwürzen“, sondern vor allem in verarbeiteten Lebensmitteln wie Brot, Käse, Wurst, Fertiggerichten und Snacks. Während einige Menschen auf diese Mengen gut reagieren, kann bei anderen bereits eine ganz normale Alltagszufuhr zu einem spürbaren Anstieg des Blutdrucks führen. Der Grund: Manche Menschen reagieren besonders empfindlich auf Salz, man spricht in diesem Fall von sogenannter Salzsensitivität. Sie ist zum Teil genetisch bedingt, tritt aber auch häufiger bei Menschen mit familiärer Vorbelastung, leicht erhöhtem Blutdruck, Übergewicht oder chronischem Stress auf. Für salzsensitive Personen ist es besonders wichtig, auf die eigene Ernährung zu achten, nicht, um sich einzuschränken, sondern um den Blutdruck aktiv mitzugestalten. Schon eine moderate Reduktion des Salzkonsums kann große Wirkung zeigen: Der Blutdruck wird stabiler, der Kreislauf ruhiger, Kopfschmerzen oder Wassereinlagerungen können zurückgehen, und langfristig sinkt das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Entscheidend ist dabei, nicht auf drastische Maßnahmen zu setzen, sondern Salz bewusst und individuell zu managen. Im Alltag heißt das vor allem: versteckte Salzquellen erkennen und reduzieren. Viele verarbeitete Lebensmittel enthalten große Mengen Salz, oft ohne, dass man es schmeckt. Wer häufiger selbst kocht, auf frische Zutaten setzt und mit Kräutern, Gewürzen, Zitrone oder Knoblauch statt mit Salz würzt, kann den Konsum deutlich senken, ohne auf Geschmack zu verzichten. Auch ein bewusster Umgang mit dem Frühstück ist hilfreich: Wurst, Käse und Brot liefern oft schon morgens fast den gesamten Tagesbedarf an Salz. Alternativen wie Joghurt mit frischem Obst, Haferflocken oder Eierspeisen mit Gemüse können hier Abwechslung schaffen. Wer häufig außer Haus isst, sollte sich bewusst sein, dass Restaurant- oder Take-Away-Gerichte meist besonders salzreich sind.
Besonders effektiv ist es, salzreiche Ernährung durch kaliumreiche Lebensmittel auszugleichen. Kalium wirkt im Körper als Gegenspieler zu Natrium: Es fördert die Ausscheidung von überschüssigem Salz über die Nieren, entspannt die Blutgefäße und wirkt damit direkt blutdrucksenkend. Gute Kaliumquellen sind Kartoffeln, Avocados, Hülsenfrüchte, grünes Blattgemüse, Bananen, Nüsse und Trockenfrüchte. Gleichzeitig sollte man auf eine gute Versorgung mit gefäßschützenden Mikronährstoffen achten, etwa Magnesium, Vitamin D, Coenzym Q10 und Omega-3-Fettsäuren. Auch sekundäre Pflanzenstoffe aus Beeren, Olivenöl, grünem Tee oder dunkler Schokolade können helfen, Entzündungen zu reduzieren und die Gefäßfunktion zu unterstützen.
Neben der Ernährung spielt auch der Lebensstil eine entscheidende Rolle. Wer sich regelmäßig bewegt, insbesondere mit Ausdauersportarten wie Gehen, Radfahren oder Schwimmen, kann seinen Blutdruck spürbar senken. Guter Schlaf, weniger Stress, ein bewusster Umgang mit Alkohol und der Verzicht auf Nikotin unterstützen die natürliche Regulation zusätzlich. Vor allem für Menschen mit einer erhöhten Salzsensitivität ist dieser ganzheitliche Ansatz besonders wirksam. Oft lassen sich dadurch sogar Medikamente vermeiden oder deren Dosierung reduzieren.
Wer weiß, wie empfindlich der eigene Körper auf Salz reagiert, kann mit einfachen Mitteln viel erreichen. Dabei geht es nicht um Verzicht, sondern um kluge, individuelle Entscheidungen. Denn nicht jeder braucht die gleiche Ernährung, aber jeder profitiert davon, seinen eigenen Bedarf zu kennen. In der Praxis bedeutet das: Salz ist nicht nur eine Zutat, sondern ein aktiver Hebel für die Gesundheit und sollte gerade bei Bluthochdruck, familiärer Vorbelastung oder in der Prävention bewusst eingesetzt werden.
Chaimati, S., Shantavasinkul, P. C., Sritara, P., & Sirivarasai, J. (2023). Effects of AGT and AGTR1 Genetic Polymorphisms and Changes in Blood Pressure Over a Five-Year Follow-Up. Risk management and healthcare policy, 16, 2931–2942. https://doi.org/10.2147/RMHP.S442983
DocCheck, M. B. (o. D.). Renin-Angiotensin-Aldosteron-System – DocCheck Flexikon. DocCheck Flexikon. https://flexikon.doccheck.com/de/Renin-Angiotensin-Aldosteron-System
El-Garawani, I. M., Shaheen, E. M., El-Seedi, H. R., Khalifa, S. A. M., Mersal, G. A. M., Emara, M. M. & Kasemy, Z. A. (2021). Angiotensinogen Gene Missense Polymorphisms (rs699 and rs4762): The Association of End-Stage Renal Failure Risk with Type 2 Diabetes and Hypertension in Egyptians. Genes, 12(3), 339. https://doi.org/10.3390/genes12030339
ensembl.org (2025) Verfügbar unter: http://www.ensembl.org/Homo_sapiens/Variation/Citations?db=core;r=1:230709548-230710548;v=rs699;vdb=variation;vf=11
Fountain, J. H., Kaur, J. & Lappin, S. L. (2023, 12. März). Physiology, Renin angiotensin system. StatPearls – NCBI Bookshelf. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK470410/
Fountain, J. H., Kaur, J. & Lappin, S. L. (2023b, März 12). Physiology, Renin angiotensin system. StatPearls – NCBI Bookshelf. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK470410/
Gautam, N., Kaur, S., Kaur, S., Kumar, S., Galhna, K. K., & Kaur, K. (2018). Computational study of ACE and AGT gene of RAAS pathway. World News of Natural Sciences, 19, 65–77. https://bibliotekanauki.pl/articles/1112240
He, F. J., Tan, M., Ma, Y., & MacGregor, G. A. (2020). Salt reduction to prevent hypertension and cardiovascular disease: JACC state-of-the-art review. Journal of the American College of Cardiology, 75(6), 632–647. https://doi.org/10.1016/j.jacc.2019.11.055
How do common variants in the AGT gene cause hypertension? (o. D.). https://www.gbhealthwatch.com/GND-Hypertension-AGT.php
MedlinePlus Genetics. (2013). AGT gene. In MedlinePlus Genetics. https://medlineplus.gov/download/genetics/gene/agt.pdf
MSD Manuals. (2025, 10. Juni). Image:Regulation des Blutdrucks: Das Renin-Angiotensin-Aldosteron-System-MSD Manual Ausgabe für Patienten. MSD Manual Ausgabe für Patienten. https://www.msdmanuals.com/de/heim/multimedia/image/regulation-des-blutdrucks-das-renin-angiotensin-aldosteron-system
Norat, T., Bowman, R., Luben, R., Welch, A., Khaw, K. T., Wareham, N., & Bingham, S. (2008). Blood pressure and interactions between the angiotensin polymorphism AGT M235T and sodium intake: A cross-sectional population study. The American Journal of Clinical Nutrition, 88(2), 392–397. https://doi.org/10.1093/ajcn/88.2.392
OpenAI (2021) ChatGPT. Verfügbar unter: https://chatgpt.com/c/67066a28-6290-8001-bdff-3c5ce95500aa
rs699 – SNPedia. (o. D.). https://www.snpedia.com/index.php/Rs699
Sanada, H., Jones, J. E., & Jose, P. A. (2011). Genetics of salt-sensitive hypertension. Current hypertension reports, 13(1), 55–66. https://doi.org/10.1007/s11906-010-0167-6
Sanada, H., Jones, J. E., & Jose, P. A. (2011). Genetics of salt-sensitive hypertension. Current hypertension reports, 13(1), 55–66. https://doi.org/10.1007/s11906-010-0167-6
Sharma, M., Raina, J. K., Bhagat, M., Sudershan, A., Panjaliya, R. K., Kotwal, S., & Kumar, P. (2024). Enlighten the association of Angiotensinogen gene (AGT) polymorphisms and hypertension in Jammu region of north Indian population: A case-control study. Human Gene, 39, 201242. https://doi.org/10.1016/j.humgen.2023.201242
Shimosawa, T. Salt, the renin–angiotensin–aldosterone system and resistant hypertension. Hypertens Res 36, 657–660 (2013). https://doi.org/10.1038/hr.2013.69